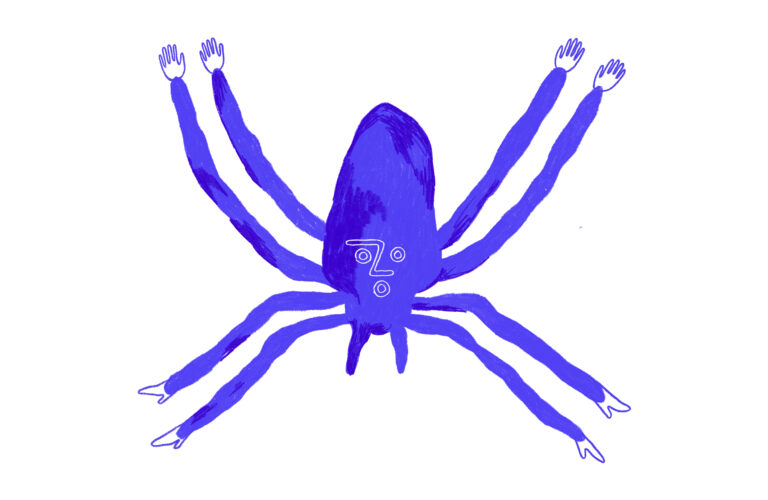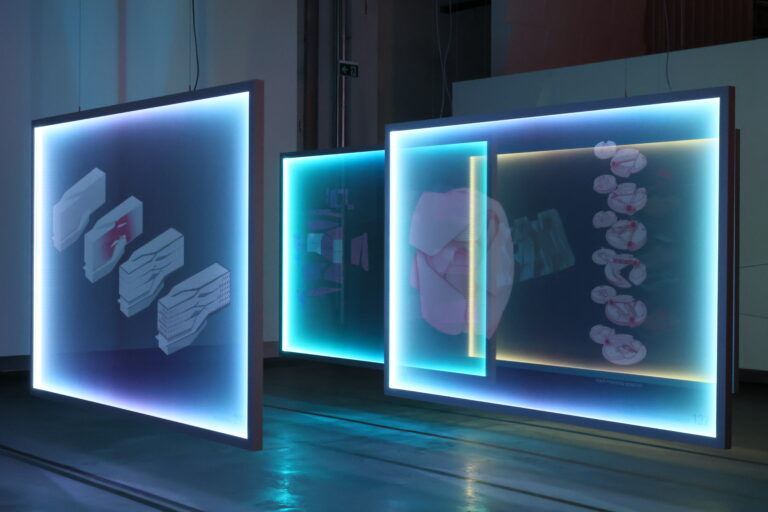Museen unter Druck: Chaos und Zerstörung – Eine Veranstaltung von ICOM Österreich
Wie viel politische Einflussnahme halten Museen aus – und was bleibt von ihrer Autonomie? Eine internationale ICOM-Diskussion im MAK Wien zeigt eindrucksvoll, wie Museen weltweit unter Druck geraten – und warum wir gerade jetzt für ihre Unabhängigkeit eintreten müssen. Ein Text von Sabine B. Vogel

© ICOM Österreich
Museen stehen unter zunehmenden Druck. Direktem politischem Druck. Wie verheerend der ist, zeigte gerade eine Podiumsdiskussion im MAK (Museum für Angewandte Kunst) in Wien. Organisiert von ICOM (International Council of Museums), waren Mitglieder aus der Slowakei, Italien, Ungarn und USA eingeladen. Schon ein Vertreter von ICOM Ungarn wies mit seinen ersten Worten die Richtung: Er habe erst nachdenken müssen, ob diese Einladung nicht zu gefährlich für ihn sei.
Seit Viktor Orban 2010 die Regierung übernahm, wird die ungarische Verfassungsordnung, das Wahlsystem und auch die Kulturlandschaft umgebaut. Mehrere Leitungsposten werden politisch besetzt mit loyalen, manchen fachfremden Personen; Gremien werden entmachtet; bestehende Museen folgen zunehmend einer regierungsnahen Perspektive. Kurz: die Kultur wird für die politische Ideologie instrumentalisiert. Zudem wurden zahlreiche neue Institutionen gegründet, darunter eine neue Ungarische Akademie der Künste – mit Geldern, die den historischen Institutionen fehlen. Ein neues Gesetz erlaubt es jetzt sogar, Kulturgüter aus den Sammlungen herauszunehmen und zu verschenken. All das führe zunehmend zu Selbstkontrolle bis Selbstzensur.
Dieser politische Umbau läuft in Ungarn seit fünfzehn Jahren. Rasend schnell dagegen passieren die politischen Eingriffe in die Kulturinstitutionen in der Slowakei, wie Dusan Buran darlegte. Er war Senior Kurator der Sammlung Alter Kunst der Slowakischen Nationalgalerie, bis er zusammen mit 100 Mitarbeiter:innen kündigte. Seit 2023 werden unter dem Ministerpräsidenten Robert Fico willkürlich die Direktionen bedeutender Kulturinstitutionen ausgewechselt, durchwegs mit fachfremden Personen, bisweilen in schneller Abfolge. Einer sei zuvor ein Filmproduzent gewesen, erzählt Buran. Was die Mitarbeiter:innen des Museums als Statement für dringend notwendige Diskussionen mit dem Kulturministerium hielten, war das finale Ende ihrer Arbeitsverhältnisse. Die kulturelle Situation fasste Buran mit weitreichenden Fragen zusammen: Wie kann die Zukunft der Museen unter solchen Umständen aussehen, wenn es keinerlei Planungssicherheit gebe? Wenn zunehmend Fachfremde in Museen arbeiten? Und wenn das Ausstellungsprogramm purer Willkür folge wie die geplante Schau des Modefotografen Bruce Weber in der Nationalgalerie?
Von ähnlichen, wenn auch weniger tiefgreifenden Zuständen berichtete Cecilie Hollberg, frühere Direktorin der Galleria dell’Accademia in Florenz. Auslaufende Direktor:innenposten werden nur noch national besetzt. Und im Ausstellungsprogramm werden kritische Aspekte ausgeblendet, wie die im April eröffnete Futurismus-Ausstellung in der Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in Rom – die ohne jegliche Erklärungen und Kontextualisierungen zur Faschismusnähe der Kunstbewegung aus dem frühen 20. Jahrhundert auskam. Die große J.R.R. Tolkien-Ausstellung, die zunächst in Rom, dann in Neapel stattfand und weiter nach Catania reist, sei zu populistisch und zu kommerzialisiert. Wichtige historische und kritische Aspekte bleiben ausgespart.
Erschreckender Höhepunkt war Deborah Ziskas Vortrag. Sie ist Vorstand des Marketing und Public Relations Committee von ICOM und von ICOM USA. Am 20. Januar 2025, dem ersten Tag seiner Amtszeit, erließ Donald Trump seinen ersten „executive order“: Jegliches „radical and wasteful government DIE“-Programm, also Diversity, Equity, Inclusivity, müsse enden. Stellenabbau und Website-Rewording waren die sofortige Folge.
Am 27. März folgte der Aufruf zum „restoring truth and sanity to American history“. Mithilfe einer „Executive Order” sollten „unpassende Ideologien“ von der Smithsonian Institution entfernt werden, um ein „positives Bild“ der US-amerikanischen Geschichte zu fördern. Das African American Museum of History and Culture, das American Art und das Women’s History Museen gerieten in den Fokus, es folgte das Verbot von Ausstellungen, die Trans*frauen im National Museum of American Women anerkennen. Im Mai begann der Abbau von mehr als 1.000 Stipendien, von Arbeitsplätzen und Budgets des NEA (National Endowment for the Arts) und NEH (National Endowment for the Humanities). Stattdessen lässt Trump seinen für 2026 geplanten „National Garden of American Heroes“ mit Statuen willkürlich ausgesuchter Personen von Politikern bis Popstars oder Astronauten finanzieren.
Wohin diese Entwicklungen führen, ist offen. Absehbar ist aber schon jetzt, dass mit solchen politischen Einflussnahmen bestehende Strukturen zerstört werden, um diese dann im Hinblick auf neue Ideologien zu füllen. Gibt es einen Ausweg? Johanna Schwanberg, Präsidentin ICOM-Österreich und Direktorin des Dom Museums Wien, mahnte: „Museen formen kollektive Erinnerung.“ Aber wie könne die Autonomie, wie die Pluralität erhalten bleiben? Lilli Hollein, Direktorin des MAK, beschwört in ihrem Statement, nicht die „Waffen des Museums“ aufzugeben: Im April 2024 hat eine Studie des Instituts für Museumsforschung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ergeben, dass die Museen mit einem Durchschnittswert von 7,4 auf einer Skala bis 10 das höchste Vertrauen unter allen öffentlichen Einrichtungen genießen – direkt nach Familie und Freunden (8,3), vor Wissenschaftler:innen und Medien. Entscheidend dafür: die Neutralität von Museen. Museen sind ein Ort des gesellschaftlichen Zusammenhalts, bieten Raum für Offenheit, Dialog und Reflexion. Hollein: „Dafür muss gekämpft werden. Wir haben eine Verantwortung für dieses Vertrauen.“